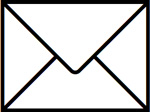Lebensmitteleinzelhandel
Wenig Markentreue bei Quick-Commerce-Anbietern
Quelle: Tim Reckmann/pixelio.de
Schnelle Lebensmittellieferdienste wie Flink und Getir etablieren sich als Alternative zum stationären Lebensmitteleinzelhandel: Viele Kund:innen der "Q-Commerce-Anbieter" (Quick Commerce) lassen sich inzwischen regelmäßig ihren Wocheneinkauf nach Hause bringen. Das zeigt eine Untersuchung der Strategieberatung Oliver Wyman (München), für die im Dezember 2022 2.100 Quick-Commerce-Nutzer in Deutschland (700 Teilnehmer), Frankreich und den Niederlanden zu ihrem Einkaufsverhalten und ihrer Zahlungsbereitschaft beim Lebensmitteleinkauf befragt wurden.
Preis und Liefergeschwindigkeit zählen
Demnach konnten die einzelnen Dienstleister wie Gorillas, Flink oder Getir bislang kaum Loyalität bei Verbrauchern aufbauen. Für die Kundschaft zählen bei der Wahl des Anbieters vor allem Preis und Liefergeschwindigkeit. Im Vergleich mit Frankreich und den Niederlanden zeigt der deutsche Markt eine größere Reife. Der Wert des durchschnittlichen Warenkorbs ist hierzulande am höchsten, gleiches gilt für die Kauffrequenz.
"Die Quick-Commerce-Anbieter haben überraschend schnell bewiesen, dass ihr Geschäftsmodell nicht nur Spontankäufe bedienen kann", sagt Jens von Wedel, Partner mit Schwerpunkt Handel und Konsumgüter bei Oliver Wyman. "Damit haben sie das Potenzial, sich zu einer ernsthaften Konkurrenz für Supermärkte zu entwickeln."
Obst und Gemüse sowie Milchprodukte liegen laut Oliver Wyman ganz vorne bei den bestellten Produkten. Fertigprodukte dagegen spielen eine untergeordnete Rolle.
Q-Commerce-Anbieter machen dem stationären Lebensmitteleinzelhandel Umsätze streitig
Knapp die Hälfte (47 Prozent) der Q-Commerce-Kunden in Deutschland beauftragen den Service zwei bis vier Mal im Monat. Mindestens fünf Mal im Monat werden die Lieferdienste von acht Prozent genutzt. Dabei ist die Zahl der Heavy User hoch. Mehr als ein Drittel (36 Prozent) der Nutzer veranschlagen den Anteil ihrer Q-Commerce-Ausgaben am gesamten Budget für Lebensmittel auf 20 bis 39 Prozent.
Viele Q-Commerce-Kunden hätten ihr Einkaufsverhalten spürbar umgestellt, sagt von Wedel. Die Hälfte der Befragten lässt sich regelmäßig von Flink und Co. sogar den kompletten Wocheneinkauf bringen. Das gehe vor allem zulasten von Supermärkten oder Discountern. Denn mehr als die Hälfte (51 Prozent) der Q-Commerce-Nutzer würden laut Erhebung auf den stationären Einzelhandel zurückgreifen, wenn es die schnellen Lieferdienste nicht geben würde – nur 22 Prozent dagegen auf alternative E-Commerce-Anbieter im Food-Segment, deren Modelle längere Bestellvorläufe vorsehen.
Höhere Kosten im Vergleich zum Supermarkt
Für den schnellen Lieferservice akzeptieren die Nutzer Mehrkosten – allerdings oft, ohne es zu ahnen. Die Mehrheit der Befragten hält Q-Commerce-Anbieter für vergleichbar teuer (60 Prozent) oder sogar billiger (17 Prozent) als stationäre Händler. Eine Analyse typischer Warenkörbe im Rahmen der Studie zeigt das Gegenteil. Die Kosten lagen laut der Meldung beispielsweise bei Flink um fünf bis 16 Prozent höher als im Supermarkt. Dazu kommen noch die Lieferkosten. Hier zeigen die Befragten eine hohe Toleranz. Für einen binnen 30 Minuten gelieferten Warenkorb im Wert von 20 Euro halten 41 Prozent einen Aufschlag von zwei Euro für gerechtfertigt. Weitere 34 Prozent akzeptieren sogar Mehrkosten von bis zu fünf Euro.
Besonders ausgeprägt ist die Kauffreude in Deutschland mit einem Wert des durchschnittlichen Q-Commerce-Warenkorbs von knapp 31 Euro unter den Befragten. Die in der Umfrage ebenfalls betrachteten Nachbarländer Frankreich (ca. 29 Euro) und Niederlande (ca. 27 Euro) liegen hier niedriger.
Wirtschaftlichkeit bleibt das Problem
Den Gesamtmarkt für Quick Commerce veranschlagt Oliver Wyman im Jahr 2022 in Deutschland auf etwa 500 bis 700 Millionen Euro – das entspricht weniger als einem Prozent des gesamten Umsatzes im Lebensmittelsektor. Etwa 0,8 bis 1,0 Millionen Nutzer:innen haben die Lieferdienste beauftragt, schätzen die Berater.
"Eine Herausforderung bleibt die Wirtschaftlichkeit des Modells", sagt von Wedel. "Bis heute hat kein Anbieter eine flächendeckende Wirtschaftlichkeit erreicht."
Die Konsolidierung des Q-Commerce-Markts hält angesichts der hohen Wettbewerbsintensität laut der Meldung an. Die Wachstumschancen gehen über indes den reinen Lebensmittelhandel hinaus: Mehr als drei Viertel der Befragten (78 Prozent) sehen Q-Commerce in Zukunft auch im Non-Food-Bereich als wichtigen Kanal.
Weitere Artikel zum Thema Lieferdienste
Weitere Meldungen, die Sie interessieren könnten:
Printausgabe
Partner-News
 Marketing- und Medien-News aus der new-business-Redaktion
Marketing- und Medien-News aus der new-business-Redaktion