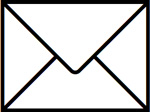Firmenzentralen in Europa werden immer größer
Weltweit definieren derzeit Konzerne die Rolle ihrer Zentralen neu: Hauptsitze werden immer mehr zum Zahnrad im Getriebe des operativen Geschäfts. Außerdem erledigen sie künftig häufiger Aufgaben, die über die Funktion des Repräsentanten, Managers oder Wächters interner Richtlinien hinausgehen. Dieser Trend ist ein zentrales Ergebnis von 'Corporate Headquarters', einer Roland Berger-Umfrage unter 86 global tätigen Unternehmen, die ihre Zentrale in Westeuropa haben. "Konzernzentralen werden immer größer und verwalten zunehmend komplexere Systeme innerhalb des Unternehmens", sagt Tim Zimmermann, Partner von Roland Berger Strategy Consultants.
Rund 80 Prozent der befragten Firmen planen demnach, ihre Zentralen in Westeuropa zu behalten. Für mehr als die Hälfte der Unternehmen soll die Zentrale zum Geschäftspartner weltweiter Niederlassungen werden. Der Standort Westeuropa bleibt dabei attraktiv, obwohl asiatische Märkte für die Geschäfte der Unternehmen weiterhin an Bedeutung gewinnen.
Ausweg aus dem Dilemma: Mehrwert versus Kosten
Ein Hauptquartier in Westeuropa zu unterhalten, stellt immer noch einen wichtigen Kostenposten für das Gesamtunternehmen dar: Zwischen zwei und sieben Prozent des Gesamtumsatzes geben Firmen im Durchschnitt für ihre Zentrale aus. Die Höhe dieser zentralen Kosten variiert dabei je nach Branche und Führungsorganisation des Unternehmens. Zeitgleich schrumpfen die Finanzmittel, die den Headquarters zur Verfügung stehen. "Aus diesem Engpass können Firmen nur dann einen Ausweg finden, wenn sie es schaffen, durch ihre kostspieligen Zentralen einen Mehrwert für die weltweiten Geschäftseinheiten darzustellen", erklärt Fabian Huhle, Co-Autor der Studie. "So können Headquarters ihre wichtige Funktion und ihre Kosten rechtfertigen."
Dafür, so das Ergebnis der Studie 'Corporate Headquarters', sollten sich Unternehmenszentralen neben ihren klassischen Steuerungs- und Koordinationsaufgaben wie Finanzierung, Rechnungslegung und Controlling stärker auf fünf wesentliche Kompetenzen konzentrieren: die Identität der Firma stärken, eine übergeordnete Konzernstrategie entwickeln, die Komplexität eines globalen Unternehmens meistern, Innovation vorantreiben, das weltweite Netzwerk fördern und schließlich die geplanten Maßnahmen international umsetzen. So kann aus dem regelmäßig in der Bewertung von Großunternehmen existierenden Abschlag (Conglomerate Discount) ein positiver Wertbeitrag der Zentrale entstehen.
Internationalisierung der Zentralen als neuer Trend
Anstatt die eigene Zentrale ins Ausland zu verlagern, ziehen es westeuropäische Firmen eher vor, die Internationalisierung ihrer Headquarters voranzutreiben: "Seit Jahren erleben wir einen deutlichen Trend: Unternehmen zentralisieren entscheidende Führungsfunktionen an deren Hauptsitz", sagt Zimmermann. "Neu ist allerdings die Tendenz, die Zentralen zu internationalisieren, um das Auslandsgeschäft besser unterstützen zu können."
Knapp 60 Prozent der befragten Unternehmen vertreten die Meinung, dass ihre Zentralen internationaler werden müssen – etwa durch grenzüberschreitende Projekte. Außerdem werden für das Management wichtige Mitarbeiter aus anderen Ländern in die Zentrale geholt. Darüber hinaus halten in den Hauptquartieren verstärkt virtuelle Führungs- und Kommunikationsinstrumente sowie flexible Projekt- und Gremienstrukturen Einzug. Damit können weltweit verteilte Standorte in einem engeren Netzwerk effizienter kooperieren. 53 Prozent der Konzerne erwarten in diesem Bereich einen Anstieg.
Outsourcing und Bündelung von internen Dienstleistungen bleiben aktuell
Um die hohen Kosten westlicher Headquarters in Grenzen zu halten, gliedern Firmen weiterhin bestimmte Service-Bereiche aus. So möchten 30 Prozent der Befragten Kapazitäten vor allem in den Feldern IT, Buchhaltung und Personal an externe Dienstleister vergeben. Damit liegen die Firmen auf dem Outsourcing-Level des Jahres 2010. Die Hälfte der Unternehmen versucht durch Service-Center für ihr Standortnetzwerk Kosten zu sparen. Diese Center sind bisher zu 80 Prozent in Europa lokalisiert. "Wir erwarten jedoch, dass die Verlagerung dieser 'shared service center' nach Asien von derzeit vier Prozent auf zehn Prozent im Jahr 2020 weiter zunehmen wird", sagt Huhle.
Rund 80 Prozent der befragten Firmen planen demnach, ihre Zentralen in Westeuropa zu behalten. Für mehr als die Hälfte der Unternehmen soll die Zentrale zum Geschäftspartner weltweiter Niederlassungen werden. Der Standort Westeuropa bleibt dabei attraktiv, obwohl asiatische Märkte für die Geschäfte der Unternehmen weiterhin an Bedeutung gewinnen.
Ausweg aus dem Dilemma: Mehrwert versus Kosten
Ein Hauptquartier in Westeuropa zu unterhalten, stellt immer noch einen wichtigen Kostenposten für das Gesamtunternehmen dar: Zwischen zwei und sieben Prozent des Gesamtumsatzes geben Firmen im Durchschnitt für ihre Zentrale aus. Die Höhe dieser zentralen Kosten variiert dabei je nach Branche und Führungsorganisation des Unternehmens. Zeitgleich schrumpfen die Finanzmittel, die den Headquarters zur Verfügung stehen. "Aus diesem Engpass können Firmen nur dann einen Ausweg finden, wenn sie es schaffen, durch ihre kostspieligen Zentralen einen Mehrwert für die weltweiten Geschäftseinheiten darzustellen", erklärt Fabian Huhle, Co-Autor der Studie. "So können Headquarters ihre wichtige Funktion und ihre Kosten rechtfertigen."
Dafür, so das Ergebnis der Studie 'Corporate Headquarters', sollten sich Unternehmenszentralen neben ihren klassischen Steuerungs- und Koordinationsaufgaben wie Finanzierung, Rechnungslegung und Controlling stärker auf fünf wesentliche Kompetenzen konzentrieren: die Identität der Firma stärken, eine übergeordnete Konzernstrategie entwickeln, die Komplexität eines globalen Unternehmens meistern, Innovation vorantreiben, das weltweite Netzwerk fördern und schließlich die geplanten Maßnahmen international umsetzen. So kann aus dem regelmäßig in der Bewertung von Großunternehmen existierenden Abschlag (Conglomerate Discount) ein positiver Wertbeitrag der Zentrale entstehen.
Internationalisierung der Zentralen als neuer Trend
Anstatt die eigene Zentrale ins Ausland zu verlagern, ziehen es westeuropäische Firmen eher vor, die Internationalisierung ihrer Headquarters voranzutreiben: "Seit Jahren erleben wir einen deutlichen Trend: Unternehmen zentralisieren entscheidende Führungsfunktionen an deren Hauptsitz", sagt Zimmermann. "Neu ist allerdings die Tendenz, die Zentralen zu internationalisieren, um das Auslandsgeschäft besser unterstützen zu können."
Knapp 60 Prozent der befragten Unternehmen vertreten die Meinung, dass ihre Zentralen internationaler werden müssen – etwa durch grenzüberschreitende Projekte. Außerdem werden für das Management wichtige Mitarbeiter aus anderen Ländern in die Zentrale geholt. Darüber hinaus halten in den Hauptquartieren verstärkt virtuelle Führungs- und Kommunikationsinstrumente sowie flexible Projekt- und Gremienstrukturen Einzug. Damit können weltweit verteilte Standorte in einem engeren Netzwerk effizienter kooperieren. 53 Prozent der Konzerne erwarten in diesem Bereich einen Anstieg.
Outsourcing und Bündelung von internen Dienstleistungen bleiben aktuell
Um die hohen Kosten westlicher Headquarters in Grenzen zu halten, gliedern Firmen weiterhin bestimmte Service-Bereiche aus. So möchten 30 Prozent der Befragten Kapazitäten vor allem in den Feldern IT, Buchhaltung und Personal an externe Dienstleister vergeben. Damit liegen die Firmen auf dem Outsourcing-Level des Jahres 2010. Die Hälfte der Unternehmen versucht durch Service-Center für ihr Standortnetzwerk Kosten zu sparen. Diese Center sind bisher zu 80 Prozent in Europa lokalisiert. "Wir erwarten jedoch, dass die Verlagerung dieser 'shared service center' nach Asien von derzeit vier Prozent auf zehn Prozent im Jahr 2020 weiter zunehmen wird", sagt Huhle.
Weitere Meldungen, die Sie interessieren könnten:
Printausgabe
Partner-News
 Marketing- und Medien-News aus der new-business-Redaktion
Marketing- und Medien-News aus der new-business-Redaktion